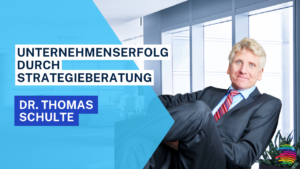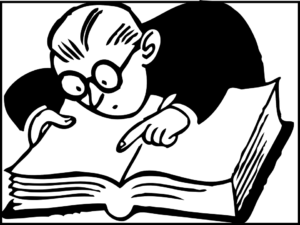Winzige Formalität nicht eingehalten – Zahnersatz muss nicht bezahlt werden
Das Medizinproduktegesetz und die Anforderungen an Zahnersatz: Warum die Formalitäten entscheidend sind Willkommen in der faszinierenden Welt der Zahnlabore, wo nicht nur handwerkliche Fähigkeiten gefragt